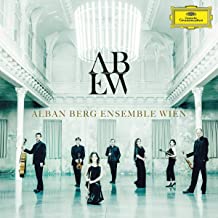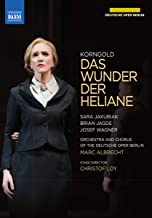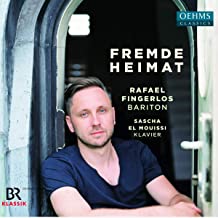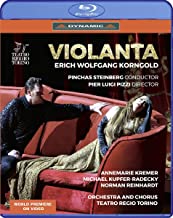Live vom Festival Verdi in Parma: “I Due Foscari” auf DVD
Giuseppe Verdis insgesamt sechste Oper I due Foscari begegnet man an Opernhäusern nördlich der Alpen so gut wie nie, auch in Verdis italienischer Heimat wird dieses frühe Werk selten aufgeführt. Das mag nicht zuletzt daran liegen, dass das Werk mit knapp zwei Stunden Aufführungsdauer ein wenig kurz für einen Opernabend geraten ist. Zusätzlich zeigt es auch deutliche dramaturgische Schwächen, die für die frühen Opern Verdis leider nicht untypisch sind. Der ursprünglich auf Lord Byron zurückgehende Stoff erschöpft sich letztlich in fortgesetzten Klagen aller Beteiligter, was eine gewisse Monotonie zur Folge hat.
(mehr …)